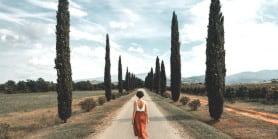Ein unverarbeitetes Trauma verändert die Gene und kann an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Mehr über die Epigenetik-Forschung.
Was ist Epigenetik?
Die Epigenetik ist ein noch recht neuer Forschungszweig der Biologie, der sich mit durch die Umwelt beeinflussten Veränderungen der Genaktivität befasst. Der Begriff setzt sich zusammen aus den Wörtern „Genetik“, also der Vererbung von Eigenschaften, und „Epigenese“, also der Entwicklung des Lebewesens.
Die Abfolge der einzelnen DNA-Bausteine ist grundsätzlich festgelegt. Allerdings wirken sich Umwelteinflüsse auf die biochemischen Prozesse im Körper aus. Epigenetische Veränderungen beeinflussen die Produktion von Proteinen, die an der DNA anhaften und damit die Genaktivität steuern.
Wissenschaftliche Untersuchungen fanden in den vergangenen Jahren heraus, dass Traumata solche Veränderungen an den Genen verursachen. Werden traumatische Erlebnisse nicht ausreichend verarbeitet, sondern immer weiter verdrängt, können diese negativ behafteten Gene an die Nachkommen vererbt werden. Die Kinder oder Enkel traumatisierter Personen fühlen dann die Trauer, Wut oder Angst ihrer Vorfahren, ohne selbst jemals ein Trauma erlebt zu haben.
Dass traumatische Erlebnisse zu Verhaltensauffälligkeiten führen, die an die nächsten Generationen weitergegeben werden, ist im Bereich der Psychologie schon lange bekannt. Durch die neuen Forschungsergebnisse der Epigenetik lässt sich dieses schwer greifbare Phänomen des transgenerationalen Traumas nun wissenschaftlich belegen.
Wie funktioniert Epigenetik?
Wie Epigenetik funktioniert, lässt sich stark vereinfacht so erklären: In jeder Zelle unseres Körpers befindet sich im Zellkern genau dieselbe DNA mit rund 25.000 Genen. Allerdings funktionieren Hautzellen anders als Nervenzellen oder Muskelzellen. Je nach Funktion wird nur ein gewisser Teil des gesamten Genoms sozusagen angeknipst oder stummgeschaltet.
Hier kommen die Umwelteinflüsse ins Spiel, die Veränderungen an den Genen bewirken und sich auf deren Aktivität auswirken. Sie beeinflussen die Produktion von Proteinen und Enzymen, die die Gene durch die Methylierung entweder an- oder ausschalten.
Das Erbgut bleibt dabei unverändert, einzig die Funktionsweise wird durch unser Verhalten, unser Umfeld und unsere Erfahrungen programmiert. Das erklärt, warum manche Menschen auf gewisse Situationen ängstlich reagieren, die anderen überhaupt nichts ausmachen.
Wer einen gesunden Lebensstil pflegt, mit seinem Leben zufrieden ist und stressige Phasen mit ausreichend Entspannung ausgleicht, überträgt die positiven epigenetischen Veränderungen an seine Nachkommen. Doch genauso wirkt sich ein ungesunder Lebensstil mit viel Stress auf die Genaktivität aus und kann dazu führen, dass auch die eigenen Kinder oder sogar Enkelkinder unter bestimmten Erkrankungen leiden oder chronische Beschwerden haben.
Das erklärt auch, warum extreme Stresssituationen durch traumatische Erlebnisse ihre Spuren an den Genen hinterlassen. Werden diese Traumata nicht ausreichend verarbeitet und die Gene wieder umprogrammiert, werden die Traumata an die nächste Generation vererbt.
Welchen Einfluss Deine familiäre Herkunft auf Dich hat: Dein kostenloser Einstieg in die Ahnenarbeit
Traumatische Erfahrungen längst vergangener Generationen können sich in Leib und Seele festsetzen und Dein Leben maßgeblich beeinträchtigen.

Wie hängt Epigenetik mit vererbten Traumata zusammen?
Wie traumatische Erlebnisse mit Epigenetik zusammenhängen, hat die Schweizer Neurobiologin Isabelle Mansuy untersucht. An der ETH Zürich führte sie Versuche mit Mäusen durch und beobachtete deren Verhalten. Es zeigte sich: Traumatische Erlebnisse führen zu epigenetischen Veränderungen, die an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Dieser Prozess wird als transgenerationale Vererbung bezeichnet.
Im Versuch versetzte das Forscherteam Mäuse nach der Geburt in eine extreme Stresssituation. Sie trennten die Babys von den Müttern, schränkten ihre Bewegungsfreiheit ein oder setzten sie unter Kälteschocks. Als Folge auf die Traumatisierung zeigten die Mäuse ein unnatürliches Verhalten. Deren Mäusekinder wuchsen unter angenehmen Bedingungen auf, zeigten jedoch dasselbe unnatürliche Verhalten. Sogar die nächsten Generationen waren verhaltensauffällig – und das, obwohl sie gar keinen Kontakt zu den ursprünglich traumatisierten Mäusen hatten. Das Trauma wurde also über die Gene weitergegeben.
Bei der Untersuchung von Blut, Spermien und Gehirn der traumatisierten Mäuse stellten die Forscher im Vergleich zur Kontrollgruppe ein Ungleichgewicht an Micro-RNAs fest. Diese Kopien des Erbguts übernehmen die Regulation und Steuerung der Genaktivität und geraten durch ein Trauma aus dem Gleichgewicht, was die Verhaltensauffälligkeiten erklärt.
Solche epigenetischen Veränderungen ließen sich auch bei Menschen feststellen, deren Vorfahren traumatisiert wurden. Viele litten unter Depressionen, Angststörungen oder einer Posttraumatischen Belastungsstörung, ohne jemals selbst Gewalt, sexuellen Missbrauch, einen Unfall oder eine Naturkatastrophe erlebt zu haben. Die Erklärung liegt in den Erlebnissen der Vorfahren: Viele durchlebten die Schrecken des Zweiten Weltkrieges und konnten sie nie richtig verarbeiten.
Was bisher noch ungeklärt ist, ist die Frage, wie genau die epigenetischen Veränderungen vererbt werden. Denn die Epigenetik gilt nur als ein Teil eines hochkomplexen Prozesses, bei dem noch viele weitere Faktoren eine Rolle spielen.
Immerhin lässt sich dadurch das schwer begreifliche Thema der Trauma-Vererbung wissenschaftlich greifbar machen und bietet für viele Betroffene völlig neue Perspektiven, psychische und psychosomatische Erkrankungen zu therapieren.
Wie können vererbte Traumata aufgelöst werden?
Vererbte Traumata können durch eine Kombination aus angepasstem Verhalten und Therapie aufgelöst werden. Denn genauso, wie sich negative Emotionen und übermäßiger Stress auf die Genaktivität auswirken, haben auch positive Erlebnisse einen Effekt. Du kannst Deine Gene also bewusst wieder umprogrammieren.
Vor allem lässt sich durch die Erkenntnisse der Epigenetik verhindern, dass verdrängte Traumata weitervererbt werden. Betroffene sollten ihre traumatischen Erlebnisse immer verarbeiten, um die Gene nicht negativ zu belasten und Unverarbeitetes an die nächste Generation weiterzugeben. Durch therapeutische Hilfe lassen sich Traumata auflösen, schöne Erlebnisse können die Gene positiv beeinflussen.
Vererbte Wunden erkennen & heilen
Jeder Mensch trägt vererbte Erfahrungen, übernommene Blockaden und alte Überlebensprogramme in sich. Gleichzeitig liegt in jedem von uns auch der Schlüssel, diese Verstrickungen zu erkennen und aufzulösen. In diesem Online-Webinar gibt Dir Sabine Lück erste Hinweise, wie Du den Einfluss Deiner Familiengeschichte auf Dein persönliches Lebensglück erkennen kannst.
Was beeinflusst die Epigenetik?
Die Ergebnisse der Epigenetik-Forschungen belegen, dass gewisse Faktoren die Gene beeinflussen und zu Veränderungen – sowohl positiven als auch negativen – führen. Solche Faktoren sind unter anderem:
- Umwelteinflüsse
- Ernährung
- Bewegung
- Schlaf
- Stress
- zwischenmenschliche Beziehungen
- Erlebnisse
Die Epigenetik liefert damit auch die Antwort darauf, warum eine gesunde Ernährung, viel Bewegung, ausreichend Schlaf und liebevolle soziale Kontakte einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben. Wir können unsere Gene bewusst durch unser Verhalten beeinflussen, umso wichtiger ist ein gesunder Lebensstil und eine positive Lebenseinstellung.
Wie beeinflusst ein vererbtes Trauma eine Paarbeziehung?
Wie sehr ein vererbtes Trauma die eigene Beziehung beeinflussen kann, stellen immer mehr Paare fest, die sich mit Epigenetik auseinandersetzen. Manchmal kommt bei genauer Betrachtung der Ahnenlinie heraus, dass ein Großelternteil ohne Vater oder Mutter aufwuchs und wir unbewusst durch unsere Beziehung die Verletzungen der früheren Generation heilen wollen.
Es kann sein, dass wir einen Partner auswählen, mit dem wir es besser machen wollen als unsere Eltern. Erlebnisse aus der Kindheit sollen den eigenen Kindern erspart bleiben, wie etwa die Trennung der Eltern, eine unglückliche Ehe oder eine unerfüllte Liebe.
Väter und Großväter trugen die traumatischen Erfahrungen aus dem Krieg in sich, die meist nicht aufgearbeitet, sondern verdrängt wurden. Mütter und Großmütter mussten ohne Vater oder Mann zurechtkommen, der vielleicht im Krieg gefallen war. Kehrten die Männer zurück, waren sie traumatisiert, emotional schwer zugänglich oder gar gewalttätig.
Diese unglücklichen Beziehungen werden durch die Epigenetik an die folgenden Generationen weitergetragen, denn Psychotherapie und die Aufarbeitung des transgenerationalen Traumas galt in früheren Generationen noch als verpönt.
Eine sichere Bindung zu den Eltern in der Kindheit ist eine wichtige Basis, um eine gute Beziehung zu sich selbst und anderen Menschen aufbauen zu können. Diese Sicherheit konnte oft jedoch nicht vermittelt werden.
Obwohl Eltern meist immer nur das Beste für ihre Kinder wollen und ihnen ein besseres Leben ermöglichen, stehen sie manchmal einer glücklichen Beziehung im Weg – völlig unbewusst. Es können auch die Großeltern sein, die uns durch Unverarbeitetes beeinflussen.
Dann suchen wir im Partner oder in der Partnerin den Vater oder die Mutter, und nicht die Person, die für uns persönlich am besten passt. Der Wunsch, das jeweilige Eltern- oder Großelternteil im Partner zu heilen, geht auf Kosten der eigenen Bedürfnisse, die dabei nicht erfüllt werden.
Ein Bewusstsein dafür kann helfen, die Hindernisse zu beseitigen und den Weg für eine glückliche Partnerschaft freizumachen.
Mit diesem Kurs kannst Du vererbte Traumata auflösen:
Wenn wir damit aufhören unsere Eltern und Ahninnen für ihr erlebtes Leid und ihre Entbehrungen entschädigen zu wollen, können wir unseren eigenen Weg einschlagen und unser wahres Potenzial entfalten.